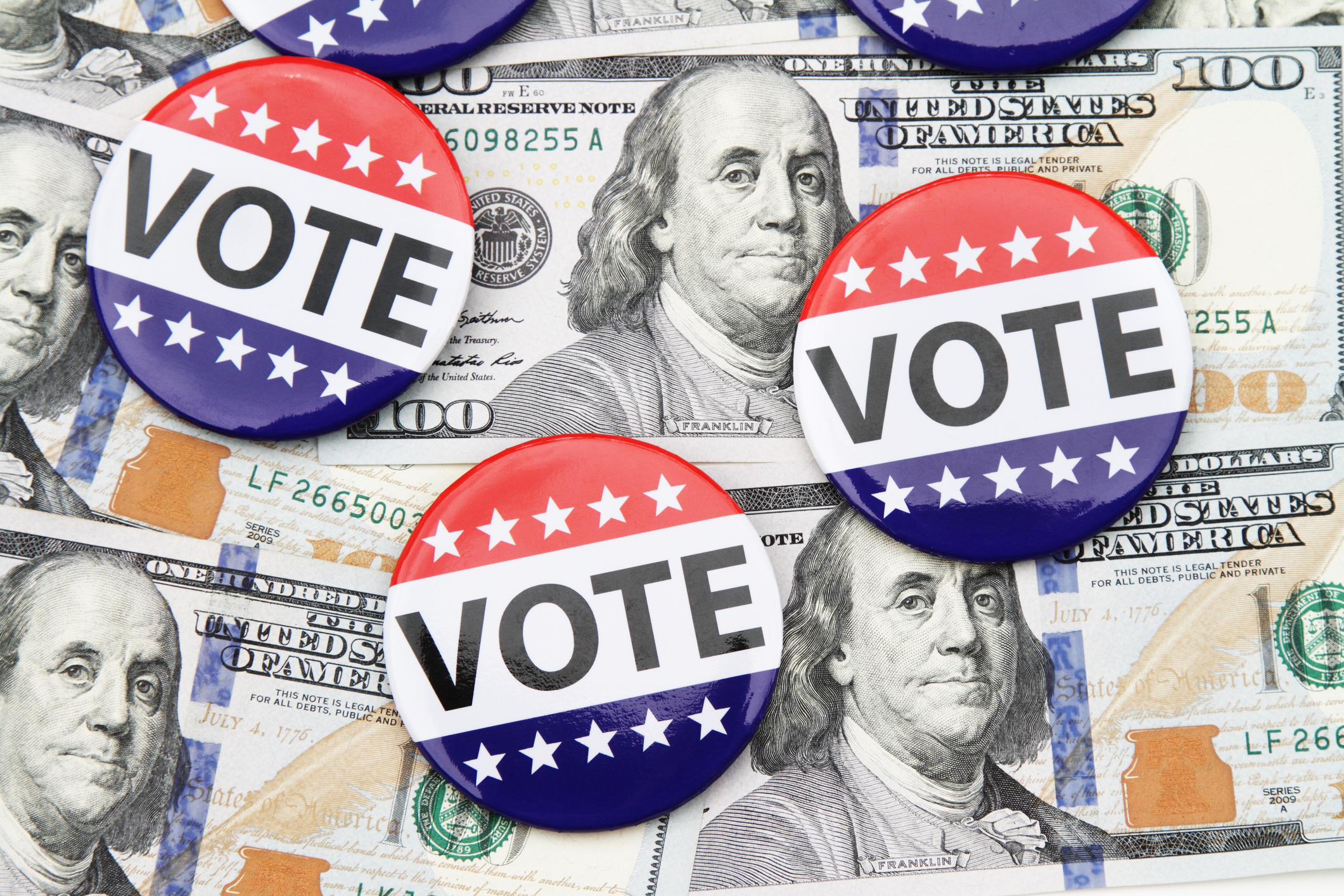BANKINGNEWS: Herr Hufeld, durch die Corona-Krise kann es zu Kreditausfällen kommen. Womit rechnen Sie?
Wir rechnen mit einer ersten Welle von Kreditausfällen im Verlauf des Jahres. Ich glaube aber, dass damit das gesamte Potenzial möglicher Kreditausfälle keineswegs erschöpft ist. Ich rechne damit, dass wir eine zweite Welle 2021 erleben werden und dass es Ausfälle geben wird.
Sehen Sie eine Bankengruppe als besonders gefährdet?
Ja, es sind sogar zwei Gruppen. Das sind zum einen Banken, die schon vor Corona Schwäche-Symptome gezeigt haben. Diese haben wir jetzt erst recht unter starker Beobachtung. Die zweite Gruppe von Banken sind solche, die zum Beispiel eine besondere Exponiertheit für die Folgen der Corona-Krise haben könnten. Das könnte durch das Zusammenkommen einer regionalen Positionierung mit einem starken Bezug zu Branchen sein, die von Corona besonders hart betroffen sind. Wenn solch eine Kumulation bestimmter Faktoren vorkommt, kann das im Einzelfall zu großen Belastungen führen.
Wie sieht es für die gesamte Branche aus?
Das hängt davon ab, wie stark der wirtschaftliche Einbruch der Realwirtschaft insgesamt ist und – vielleicht noch wichtiger – wie schnell sich die Wirtschaft davon wieder erholen wird. Das ist der entscheidende Faktor. Alle Banken, besonders die großen, und alle öffentlichen Instanzen arbeiten mit Stress- und Wenn-Dann-Szenarien, die man zwar abstrakt berechnen kann, aber niemand ist derzeit in der Lage, bestimmte Wahrscheinlichkeiten hinzuzufügen.
Werden jetzt Prüfungen gelockert oder muss man dem „Betteln“ einiger Bankleiter entgegentreten, weil Banken ja noch fester sein müssen als in der letzten Krise?
Banken werden nicht dadurch fester, dass man eine „Regulierung light“ anbietet. Wenn es eine Erkenntnis der Finanzkrise gab, dann diese. Ansonsten glaube ich, es geht auch um präzise Formulierungen, weil ich immer so etwas wie Erleichterung und Rücknahme von Regulierung höre oder lese. Das trifft nicht ganz den Punkt.
„Es geht um die Flexibilität, die in der Regulierung angelegt ist.“
Sondern?
Es geht um die Flexibilität, die in der Regulierung selbst angelegt ist, etwa die Nutzung bestimmter Kapitalpuffer. Da sagen wir, dass sie in Krisenzeiten ganz oder teilweise aufgezehrt werden dürfen oder in sie hinein verzehrt werden darf. Das würden wir unter normalen Umständen natürlich nicht gerne sehen. Bei einer Ausnahmesituation wie der jetzigen, in der ein wesentlicher Beitrag der Banken darin besteht, die Realwirtschaft mit Krediten zu versorgen, weisen wir darauf hin, dass ein temporärer Verzehr solcher Puffer aufsichtlich nicht beanstandet wird.
Nicht ganz das, was Sie wollen, oder?
Damit nehmen wir keine Regulierung zurück, sondern wenden sie bestimmungsgemäß an. Deswegen ist klar, dass zu einem angemessenen Zeitpunkt, wenn die Krise vorbei ist, natürlich ein regulatorischer Normalzustand einkehren muss.
Wie prüfen Sie denn derzeit?
Prüfer von BaFin, Bundesbank und EZB fahren zurzeit nicht zu Vor-Ort-Prüfungen. Dass das offensichtlich ein temporärer, krisenbedingter Umstand ist, liegt auf der Hand und auch, dass wir abwägen: Wann schicken wir die Prüfer wieder raus?
Und Basel III?
Die Umsetzung von Basel III wird um ein Jahr verschoben. Das heißt aber gleichzeitig: Natürlich setzen wir Basel III um. Wie genau, ist Teil einer Debatte im europäischen legislativen Prozess. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der gemeinsame Nenner auf Seiten der Regulatoren und Aufseher ist, eine temporäre krisenbedingte Flexibilität zu schaffen, die selbstverständlich darauf ausgelegt ist, zu einem angemessenen Zeitpunkt auch wieder zurückgenommen zu werden. Aber Fragen danach, was genau bei dem Review von MiFID II geändert werden soll und wie genau man Basel III umsetzen soll, sind normale Rhythmen der regulatorischen Überprüfung. Und dabei ist es völlig legitim, dass die Industrie ihre Ideen vorträgt und wir als Regulatoren und die Politik, inklusive der europäischen Ebene darauf reagieren und, vielleicht sagen: Ja, da ist ein Punkt, auf den wir eingehen und woanders sagen: Nein, da bleiben wir strikt.
Politik ist ein gutes Stichwort. Haben Sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als Olaf Scholz gesagt hat, dass die Banken bei der Kreditvergabe ruhig mal „Fünfe gerade sein lassen“ sollen?
Ich glaube, er hat damit in einer allgemein verständlichen Form deutlich gemacht, dass die Banken die Vergabe der KfW-Hilfskredite mit einem Minimum an Bürokratie prüfen sollen. Da wurde das Ausfallrisiko fast vollständig vom Staat übernommen. Aber dort, wo Banken ins Risiko gehen, müssen sie immer Risikomanagement betreiben. Daran gibt es nicht die geringsten Zweifel.
Kritik richtet sich nicht gegen Regulatorik an sich, sondern zielt auf den regulatorischen Flickenteppich oder fehlende Einheitlichkeit in Europa. Was vermissen Sie bei der Harmonisierung von Regulatorik?
Das ist ein weites Feld. Das sieht man besonders bei der Geldwäscheprävention. Dafür gab es bisher eine europäische Richtlinie, die einen gewissen Grad an Mindestharmonisierung vorgibt, aber rechtlich harte Wirksamkeit erst durch nationale Gesetze erzeugt. Das hat es ermöglicht, dass mehrere Länder die Umsetzung in nationales Recht schlicht und ergreifend nicht oder nicht rechtzeitig vorgenommen haben. Es ist skandalös, dass das ausgerechnet bei einem Thema wie Geldwäscheprävention passiert.
Also ist die Lösung mehr regulatorische Harmonisierung in Europa?
Ja, bei der Geldwäscheprävention würde ich eine europäische Verordnung, die unmittelbar geltendes Recht darstellt, stark befürworten. Dann haben Sie es erstens aus einem Guss und zweitens am Tag der Inkraftsetzung in allen Ländern als geltendes Recht.
Warum gibt es eigentlich keine europäischen Bankenfusionen mit deutscher Beteiligung und wo sehen Sie aus Sicht der Aufsicht Schwierigkeiten?
Das ist eine wirtschaftliche Fragestellung, über die der Markt und die Marktteilnehmer primär zu entscheiden haben. Die Entscheidung, eine andere Bank zu kaufen oder mit ihr fusionieren zu wollen, muss eine Bank treffen und nicht der Aufseher.
Von den Banken hört man, es liegt an europäischer Regulatorik, dass es nicht funktioniert.
Wenn ein Banker so etwas sagt, hat er nie ernsthaft den Willen gehabt, mit einer anderen Bank zu fusionieren. In der EU ist die Bankenregulierung zu 90 oder 95 Prozent harmonisiert. Es gibt nicht den geringsten regulatorischen Grund, einen Merger zu unterlassen, wenn man ihn strategisch will. Um noch mehr Transparenz über geltende aufsichtliche Maßstäbe zu erreichen, haben wir seitens der EZB kürzlich ein Papier veröffentlicht, indem unsere grundsätzliche Positionierung weiter verdeutlicht wird.
„Die Würfel fallen bei den beteiligten Partnern, nicht bei Aufsehern.“
Was macht eine länderübergreifende Fusion so kompliziert?
Ein Merger oder eine Übernahme ist nicht gerade ein triviales Unterfangen. Das ist teuer, erfordert viel Senior Management Attention und bindet große Kapazitäten. Banken schauen sich natürlich kontinuierlich Optionen an. Das ist Teil des Pflichtenheftes des CEO einer Bank. Ob er es dann tatsächlich tut, hängt davon ab, ob er den Anteilseignern vorrechnen kann, dass das eine werterhöhende Maßnahme ist. Und oft stellt sich heraus, dass das nicht so werterhöhend ist, wie manche glauben. Größe allein erzeugt noch keinen Wert. Der limitierende Faktor für M&A bei Banken ist nicht die Regulierung, sondern die ökonomische Sinnhaftigkeit und die operative Durchführbarkeit. Die Würfel fallen bei den beteiligten Partnern, nicht bei uns Aufsehern.
Bei Libra sind die Würfel noch nicht gefallen. Könnte mit der geballten Macht von Facebook die Kryptowährung nicht trotzdem bald kommen?
Der entscheidende Punkt ist Facebook selbst. Die Konzernführung hat gesagt, dass sie in keinem Land und zu keinem Zeitpunkt starten werde, bevor sie nicht eine klare Zustimmung und Vereinbarung durch die zuständigen Regulatoren haben. Das ist eine sehr vernünftige Geisteshaltung in einer Industrie, die seit über hundert Jahren reguliert ist. Im Fokus steht hier die Schweiz und unsere Kollegen von der FINMA, die mit uns und anderen wichtigen europäischen Länder mit Facebook und Libra im Gespräch sind.
An Facebook kann man sehen, was in der Plattformökonomie gilt: The winner takes it all. Wie wollen Sie damit denn umgehen, wenn Big Techs in der Finanzindustrie noch bedeutender und systemrelevanter werden?
Dieser Trend besteht in der Tat und hierfür muss der regulatorische Werkzeugkasten erweitert werden. In einer neuen digitalen Welt, in der auch die Wertschöpfung für Finanzprodukte immer stärker aufbricht, kann es in der Tat passieren, dass nur noch ein kleiner Teil der Wertschöpfung von einem lizenzpflichtigen Finanzinstitut erbracht wird und ein großer Teil von einem Tech-Konzern, der selbst gar kein Finanzinstitut ist.
Daraus folgt?
Das erzwingt aus meiner Sicht ein Überdenken der heutigen Regulierung. Das ist aber darstellbar, etwa indem man regulatorische Verhaltensvorgaben formuliert, die jeder zu erfüllen hat. Das ist auch nichts Neues. Wir machen das seit vielen Jahrzehnten in der Wertpapierregulierung. Das heißt ja nicht, dass wir als BaFin Volkswagen beaufsichtigen oder andere Industriekonzerne. Sie müssen aber sehr wohl in ihrer Eigenschaft als Aktiengesellschaften kapitalmarktrechtliche Verhaltensvorschriften oder Marktmissbrauchsvorgaben befolgen, die wir beaufsichtigen. Diese Logik kann man genauso anwenden, indem Verhaltensvorgaben gegenüber Google oder Amazon formuliert werden. Auf diese Weise kann man den regulatorischen Radarschirm erweitern, ohne dass wir zu einem umfassenden Aufseher eines Gesamtunternehmens namens Amazon oder Google werden würden. Das hatten wir ohnehin nie vor und würde auch keinen Sinn machen.
„Berichte über den Untergang der deutschen Banken sind stark übertrieben.“
Müssten Banken mehr wie Struktur- oder White-Label-Anbieter denken? Manchmal hört man von Banken den Vorwand, dass sie keine Cloud nutzen dürfen.
Sagen Sie mir jetzt bitte nicht, dass Ihre Leser aus der Bankbranche sagen, die Aufsicht würde ihnen verbieten, die Cloud zu nutzen.
Lange Zeit hieß es, das sei Auslagerung.
Auslagerung per se ist nicht verboten, sondern muss nur in der Risikoanalyse von Banken adäquat bewertet werden. Wir haben überhaupt nichts dagegen, dass Institute die Cloud oder andere externe Dienste nutzen, solange sie dafür eine hinreichende Kontrolle gewährleisten können.
Ist es so einfach?
Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass sich Banken den Herausforderungen der Digitalisierung stellen müssen und dass sich der Wettbewerb fundamental verändert. Ich sage aber auch, frei nach Oscar Wilde: Berichte über den Untergang der deutschen Banken sind stark übertrieben. Ich glaube, dass viele Banken eine großartige Zukunft haben. Der entscheidende Punkt ist, dass diese Zukunft nicht von selbst kommt, sondern erkämpft werden muss. Ich glaube, dass sich in den nächsten Jahren unterschiedliche Erfolgstypen beim Bankmodell stärker herauskristallisieren werden als heute.
An welche denken Sie?
In der Tat könnten Banken als White-Label-Partner erfolgreich sein. Sie könnten als reiner Serviceanbieter erfolgreich sein. Sie können aber auch als Bank in der Region X erfolgreich sein, in der sie schon seit hundert Jahren sind und einen fantastischen Kundenstamm haben, an den Tech-Unternehmen so schnell nicht herankommen. Vielleicht wollen diese dann mit der Bank kooperieren. Dann haben sie eine andere Wertschöpfung. Ich sage nur: Der überkomplexe, breitgefächerte Bauchladen ist jedenfalls für die meisten Banken nicht das Modell der Zukunft. Das können sich nur wenige Bankgiganten leisten.
Interview: Thomas Friedenberger, Thorsten Hahn
Tipp: Sie möchten mehr aus der Rubrik „Politik & Aufsicht“? Dann lesen Sie auch die Interviews mit Iris Bethge-Krauß, Hauptgeschäftsführerin des VÖB, und mit Jörg Kukies, Staatssekretär im Finanzministerium.